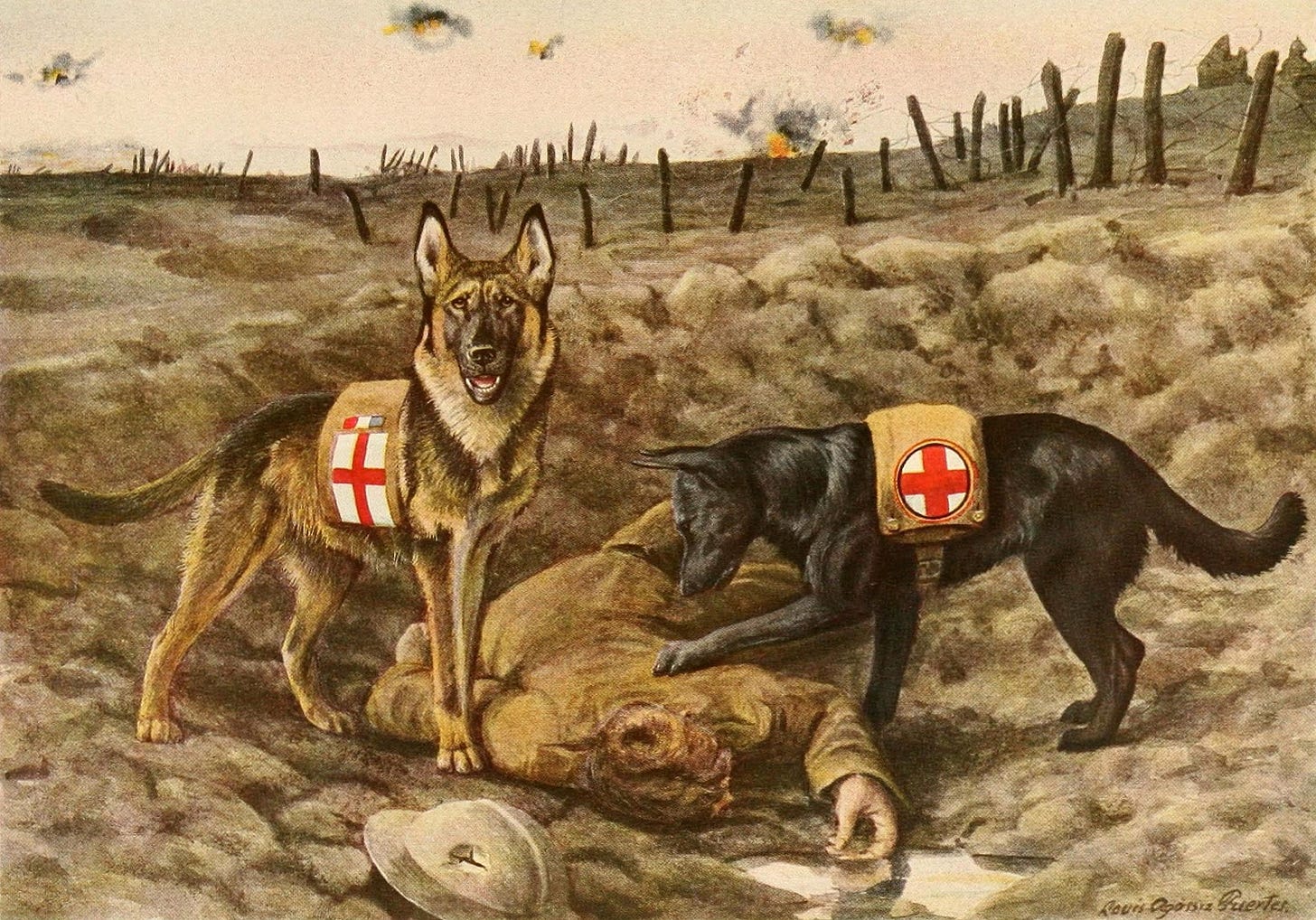Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihren Geschichtsunterricht, die Schlacht von Verdun. Die Strategie zur Niederwerfung Frankreichs war 1914 gescheitert. Der Schlieffenplan des deutschen Generalstabs hatte vorgesehen, in einer großen Zangenbewegung durch die Niederlande und Belgien den französischen Armeen, die in einem gewaltigen Befestigungsbollwerk mit Front zum Rhein gegen einen deutschen Angriff in Stellung gegangen waren, in den Rücken zu fallen und damit den Erzfeind Frankreich zur Kapitulation zu zwingen. Der Angriffsschwung kam zum Erliegen. Die vorstürmenden Divisionen mussten Halt machen, weil der Nachschub nicht mithalten konnte. Es trat das ein, was man eigentlich verhindern wollte. Man musste sich in Verteidigungsstellungen eingraben. Von Flandern in Belgien über den Norden Frankreichs bis an den Rhein lagen sich vier Jahre lang Millionen von Soldaten in einem blutigen Stellungskrieg gegenüber. Trotzdem die Generale um die mörderische Wirkung von Maschinengewehren und schnell und weit schießender Artillerie wussten, haben sie vier Jahre lang Millionen von Soldaten Tag für Tag ins Feuer geschickt. Die Schlacht um Verdun gilt als Symbol für diesen Wahnsinn. Von Februar bis Dezember 1916 tobte die Schlacht zwischen Deutschen und Franzosen um diese französische Festung. Über 300 000 Soldaten sind dabei ums Leben gekommen. Generale hatten den Wahnsinn zur Strategie erklärt. Man wollte so lange gegen die Festung anrennen, bis die Franzosen „weiß bluten“, erklärte der deutsche General von Falkenhayn. Am Ende waren die Verluste auf beiden Seiten ungefähr gleich (377 000 französische und 337 000 deutsche Soldaten).
Das ist doch längst Geschichte, werden Sie denken. Wir haben unsere Lektionen gelernt. Krieg ist zumindest unter den Demokratien des Westens kein Mittel der Politik mehr. Warum sollen wir uns also noch mit Geschichte, insbesondere Kriegsgeschichte, beschäftigen? – Diese Ansicht ist weit verbreitet. Dabei könnten wir gerade aus der Kriegsgeschichte auch heute noch sehr viel lernen. Denn Krieg handelt nicht nur von den klassischen Militärthemen wie Strategie, Taktik und Waffentechnik, sondern bietet Einblick in ein menschliches Phänomen, das in seiner Brisanz kaum Beachtung findet. Ich halte es für die Hauptursache für das Leiden von Millionen von Menschen in Kriegen und Krisen unserer Zeit. Man könnte es als das „Verdun-Syndrom“ bezeichnen. Menschen werden einer Strategie geopfert, und wenn die gesteckten Ziele nicht erreicht werden, ist man bereit, noch mehr Menschen zu opfern.
Dieses Verhalten hat systemische und menschliche Gründe. Letztere hat der britische Autor Norman Dixon, Psychologe und vormals Oberstleutnant der Royal Army, hauptsächlich im Charakter der Verantwortlichen gesehen. In seinem Buch `On the psychology of military incompetence´ hat er Psychogramme von britischen Generalen in Kriegen des 19. Und 20. Jahrhunderts erstellt, die die schlimmsten Niederlagen und größten menschlichen Katstrophen angerichtet hatten und kommt zu dem Schluss, dass die Charakterzüge dieser Führungspersonen immer auch ein Spiegelbild der Gesellschaft waren, in der sie gelernt hatten. Er nennt u.a. Eitelkeit, Karrieredenken, Bildungslosigkeit und Gefühllosigkeit für die anvertrauten Menschen als Hauptursachen. Ich wage zu behaupten, dass Dixons Beobachtungen auch auf Kriege und Krisen der Neuzeit anwendbar sind. Als Beispiele möchte den Krieg in Afghanistan nennen und die Corona-Pandemie. In beiden Fällen wurden bzw. werden folgenschwere Entscheidungen getroffen, die viel menschliches Leid gebracht hat und dessen Ende nicht abzusehen ist. Sie kann man nicht vom Charakter der Verantwortlichen trennen. Diese seriös offenzulegen, verhindert der Zeitgeist. Man wird es als Diffamierung und unfairen Angriff auf die Integrität ansehen. Eine spätere Geschichtsschreibung wird sie an den Tag bringen. Was man aber schon jetzt tun kann und tun muss, ist an den Verstand der Menschen appellieren und auf die Unmenschlichkeit und Sinnlosigkeit eines Denk und Handlungsmuster hinweisen, das ich das Verdun-Syndrom nenne.
Das Muster entspringt einer Kultur, die in der Aufklärung ihren Ursprung hatte. Der Glaube an das Messbare. Ein signifikantes Merkmal ist die Trivialisierung der Erscheinungen in der wahrnehmbaren Welt, das Vertrauen in die Berechenbarkeit aller materiellen und nicht materiellen Möglichkeiten. Alle Kriege der Neuzeit wurden in diesem Geist geplant und geführt. Das Verdun-Syndrom setzt dann ein, wenn die gesetzten Ziele nicht erreicht werden. Als klassisches Beispiel sei hier der Afghanistan-Krieg genannt. Er dauerte 20 Jahre. Die Ziele, Ausschaltung der Taliban und die Demokratisierung des Landes, wurden trotz technischer und militärischer Allmacht von USA und NATO nicht erreicht. Obwohl die Opferzahlen stetig anstiegen, ging das Töten Jahr für Jahr weiter. Als die US und NATO-Truppen abzogen und die Taliban wieder die Macht im Land übernahmen, hatten 45 000 afghanische Zivilisten und jeweils 70 000 Soldaten und 70 000 Taliban ihr Leben verloren (Quelle: Wikipedia; Zahlen sind gerundet). Da stellt sich die Frage: Wann ist der Zeitpunkt gekommen, aufzuhören und umzudenken? – Meine Antwort: Wenn man sicher ist, dass man alles richtig macht, einem aber das Ergebnis nicht gefällt. Die bisherige Strategie aufgeben wird dann zu einem Imperativ, wenn sie Menschen frisst. Mit diesem starken Ausdruck meine ich nicht nur die physische, sondern auch die existenzielle, soziale und psychische Vernichtung. Das Erleben von Gewalt, Vertreibung, Rechtlosigkeit und Angst in und nach Kriegen erzeugt immer wieder Millionen von Opfern. Diese Tatsache wird bei der statistischen Aufarbeitung von Kriegen häufig übersehen. Diese Opfer sind aber nicht auf Kriege beschränkt. Auch in der zivilen Welt können Strategien Menschen fressen. Das Verdun-Syndrom befällt auch immer wieder Politiker, Experten, Manager der Wirtschaft, ja eigentlich jeden von uns. Es ist das Anrennen gegen die Betonmauer nutzlos gewordener Denkmuster im Hirn in der Hoffnung, dass sie einfallen möge. Ich möchte am Beispiel der Corona-Pandemie einen Transfer wagen.
Als das Virus zu Beginn des letzten Jahres auf unseren Schirmen auftauchte, begann man zu messen und Statistiken anzufertigen. Strategische Ziele wurden formuliert und Zielerreichungskriterien (Inzidenzen) festgelegt. Es galt, Risiko-Gruppen vor Ansteckung zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems (hier: Intensiv-Kapazitäten) zu verhindern. Die Maßnahmen, die zur Zielerreichung getroffen wurden – Social Distancing, Lockdown, Testen, Impfung – haben nicht nur Zielerreichung geführt. Man hat Zielerreichungskriterien verändert, um Maßnahmen zu rechtfertigen. Ohne Erfolg. Sind nicht alle diese Maßnahmen wie das Anrennen der deutschen Armeen gegen die Festung Verdun? Die Opfer sind keine toten Soldaten, sondern Millionen von Menschen in unserem Volk. Socia Distancing hat alte Menschen, Kinder und Familien in die Isolation geschickt und krankmachenden seelischen Stress erzeugt. Die Lockdown haben viele Tausend Existenzen vernichtet. Politiker, deren Experten und Medien haben durch ihre Verlautbarungen in der Bevölkerung Angst geschürt und tun es bis heute. Denunziation und Diffamierung von Andersdenkenden haben zu einem Bruch im sozialen Zusammenhalt geführt. Menschen werden zur Impfung genötigt und damit zur Aufgabe ihres Rechtes auf körperliche Unversehrtheit, damit sie auch weiterhin „dazu gehören“ können. Wie weit werden sie das „Weißbluten“ noch treiben? Welche Maßnahmen werden sie entscheiden, wenn die jetzt gefassten Beschlüsse, radikaler Lockdown bzw. Ausschluss von nicht-Geimpften vom sozialen Leben, die gestiegenen Inzidenzzahlen nicht reduzieren, wenn diese sogar noch weiter ansteigen? - Erklärung eines außerordentlichen Notstandes? – Totale Ausgangssperre für alle? – Bewaffnete Bundespolizei auf den Straßen unterstützt von Soldaten, um die Ausgangssperre durchzusetzen? – Diese Spekulationen sind natürlich Übertreibungen. Ich benutze sie, um das Phänomen des Verdun-Syndrom deutlich zu machen. Der einzige Weg aus diesem Dilemma muss mit der Erkenntnis beginnen, dass trotz aller richtig befundenen Maßnahmen die gesteckten Ziele nicht erreicht werden können. Dann ist neues Denken und damit eine menschenwürdige Lösung möglich. Den bisherigen Weg zu verlassen ist aber nicht nur ein Gebot der Vernunft, sondern der demokratischen Gesinnung. Wer den Artikel 1 des Grundgesetzes ernst nimmt, der muss die bisherige Corona-Strategie aufgeben, denn sie frisst Menschen.